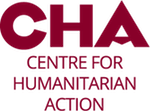| Autor*in: | Eva Maria Fischer |
| Datum: | 26. März 2025 |
Eine politische Erklärung zu Explosivwaffeneinsätzen soll das humanitäre Völkerrecht stärken
Wenn Bomben oder Granaten in Wohngebieten einschlagen, stammen 90 % der Getöteten und Verletzten aus der Zivilbevölkerung, wie Zahlen der NGO Action on Armed Violence über einen Zeitraum von zehn Jahren kontinuierlich gezeigt haben. Auch mit dem besten Willen kann man diese seit Jahren wiederkehrende dramatische Situation nicht als völkerrechtskonform darstellen. Das humanitäre Völkerrecht verbietet den gezielten Beschuss der Zivilbevölkerung, der dennoch in immer mehr Konflikten an der Tagesordnung zu sein scheint. Gleichzeitig fordert es auch beim legitimen Beschuss militärischer Ziele die Unterscheidung von zivilen Zielen und die Verhältnismäßigkeit jeden Einsatzes. Können 90% zivile Opfer als verhältnismäßig betrachtet werden? Eindeutig nein!
Als Reaktion auf dieses Leidensmuster und von der politischen und humanitären Szene in Deutschland kaum wahrgenommen, wurde in Dublin Ende 2022 nach langen Verhandlungen eine politische Erklärung „zum besseren Schutz der Zivilbevölkerung vor den humanitären Folgen des Einsatzes von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten (EWIPA)“ verabschiedet.
Ich möchte in diesem Text dazu einladen, diese Erklärung etwas näher zu betrachten, die immerhin bereits von über 80 Staaten unterzeichnet wurde, darunter durchaus engagiert auch Deutschland. Dabei möchte ich auch drei beeindruckende Frauen aus Syrien und der Ukraine vorstellen, die sich gemeinsam mit dem NGO-Netzwerk INEW für eine konsequente Umsetzung dieser Erklärung einsetzen.
Die politische Erklärung zu EWIPA
„Das Einzige, was die Menschen in einem Konfliktgebiet tun können, ist, sich aufs Überleben zu konzentrieren, weil es keine Möglichkeit für ein normales Leben mit Plänen, Hoffnungen und Erfolgen gibt. Das Gefühl von Frieden und Sicherheit ist weg und wird durch Angst und Unsicherheit ersetzt. Und die Unsicherheit ist für Frauen wie meine Schwester und mich noch größer. Bei der Bombardierung der Zivilbevölkerung gehen nicht nur Leben, Städte und Häuser, sondern auch die Zukunft der Menschen verloren.“
Starke Sätze der jungen Syrerin Nujeen Mustafa, die lange Zeit Bombardierungen in ihrer Heimatstadt Aleppo erleben musste, bevor sie sich schließlich in ihrem Rollstuhl auf die lange und gefährliche Flucht nach Deutschland machte: erst mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer und dann über acht europäische Ländergrenzen hinweg. Nujeen teilte diese Erfahrungen 2022 bei der Konferenz zur Unterzeichnung der politischen Erklärung zu EWIPA in Dublin 2022.
Unter anderem waren es die Eindrücke aus Syrien, die zu dem Prozess geführt hatten, aus dem die politische Erklärung hervorging. Die unerwartet starke Unterstützung der NATO-Staaten für die Erklärung – 29 NATO-Staaten waren unter den Erstunterzeichnern, sogar die USA – steht aber sicherlich auch im Zusammenhang mit den Erfahrungen und Positionierungen im Ukrainekrieg. Heute, über zwei Jahre später, sehen wir wiederum in Gaza oder im Sudan – nur um einige wenige Beispiele zu nennen –, wie sich die Zahl ziviler Opfer durch Bombardierungen und Beschuss ständig erhöht.
Der Einsatz von Explosivwaffen im Gazastreifen und in Israel seit Oktober 2023 war die Hauptursache für den dramatischen Anstieg der zivilen Opferzahlen im Jahr 2023 verglichen mit 2022. Im Jahr 2024 entfielen etwa 40 Prozent aller weltweit gemeldeten zivilen Opfer auf die besetzten palästinensischen Gebiete. Im Sudan stieg die Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2023 deutlich an, nachdem im April Kämpfe zwischen dem Militär des Landes, den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) ausgebrochen waren. Gleichzeitig ist der Zugang zu humanitärer Hilfe in vielen aktuellen Konfliktregionen weiterhin blockiert, was verheerende Auswirkungen auf die betroffenen Menschen hat.
Die politische Erklärung muss konkret implementiert werden
Aus all diesen Gründen ist es das zentrale Anliegen der Erklärung, das humanitäre Völkerrecht zu stärken und durch klare Leitlinien und praktische Erfahrungen konkreter zu machen. Das gilt zunächst für militärische Vorgaben und Einsatzpraktiken. Die politische Erklärung verpflichtet dazu, diese im Austausch untereinander auf den Prüfstand zu stellen. Natürlich betonen die meisten Unterzeichnerstaaten, dass sie sich bereits streng an völkerrechtliche Vorgaben halten. Dennoch ist das Interesse an konkretem Austausch darüber, wie das aussehen könnte, groß. Zum Beispiel bei einem militärischen Workshop im Rahmen der Implementierung der politischen Erklärung, der in Wien Anfang 2024 stattfand. Ich bin mit Marwa Almbaed dorthin gereist. Die junge Frau wurde in ihrer Heimatstadt Damaskus bei einer Bombardierung schwer verletzt. Der Weg zum nächsten erreichbaren Krankenhaus führte durch mehrere Checkpoints und dauerte viele wertvolle Stunden. Heute ist die früher begeisterte Tangotänzerin auf einen Rollstuhl angewiesen. In Wien teilte sie ihre Geschichte auf einem Panel, bei dem neben sie neben hochrangigen Militärs und Diplomat*innen vertreten war und vor einem Publikum aus Militärangehörigen aus verschiedenen Ländern. Immer wieder brachte sie sich auch in die anschließende Diskussion und die konkreten Austauschforen ein.
Wenn von notwendigen Kollateralschäden gesprochen wird, erinnerte sie daran, was dieses Wort konkret bedeuten kann: Getötete und verletzte Frauen, Kinder, Männer oder zerstörte Krankenhäuser. Und sie fragte in die Runde „Wer von ihnen hat schon einmal mit seiner Familie im Kriegsgebiet gelebt?“ Betretenes Schweigen.
Die humanitären Verpflichtungen der politischen Erklärung
In einem weiteren Aspekt soll die politische Erklärung zu EWIPA dazu helfen, die Umsetzung der Bestimmung des humanitären Völkerrechts durch Austausch und konkrete Beispiele und Regeln zu verbessern. Es geht um die humanitären Verpflichtungen in der Erklärung: Während bewaffneter Konflikte einen schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu erleichtern, die Opfer zu unterstützen und nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte Daten zu sammeln und weiterzugeben – keine neuen Vorgaben. Was jedoch ihre Umsetzung im Rahmen der besagten Erklärung konkret bedeutet, wird in einer Serie von Workshops erörtert, zu denen Handicap International seit 2024 Expert*innen von Geberländern und betroffenen Staaten, UN-Organisationen und INGOs einlädt. Ganz nah an der Praxis werden dort vier verschiedene Themenfelder diskutiert und in Berichten dokumentiert: Humanitärer Zugang, Zugang zu medizinischer Versorgung, Risikoaufklärung und Konfliktbewusstsein, und schließlich vulnerable Gruppen und besondere Bedürfnisse der von EWIPA betroffenen Bevölkerungsgruppen.
Auch bei diesen Workshops sind wieder als besondere Expert*innen direkt betroffene Menschen beteiligt – so wie Olha Lieshukova aus der Ukraine: Beim letzten Workshop schilderte sie offen, wie sie als chronisch kranke Frau im Kriegsgebiet lebte. Wie ihr Haus bombardiert wurde. Wie die dringend benötigten Medikamente nicht mehr verfügbar waren und ihr Mann beim stundenlangen Warten vor der Apotheke von einer Rakete getroffen wurde und sein Gehör verlor, da er nicht rasch genug medizinisch versorgt werden konnte. Olhas Fazit: „Wir müssen begreifen, wie wichtig es ist, das Funktionieren medizinischer Einrichtungen auch in Kriegszeiten aufrechtzuerhalten und humanitäre Hilfe zu leisten, die Leben, Gesundheit und die Zukunft der Menschen rettet.“
Eine Chance zur Stärkung des humanitären Völkerrechts?
Wird die politische Erklärung zu EWIPA irgendwann konkrete Auswirkungen haben? Wird sie dazu beitragen können, dem Völkerrecht wieder mehr Beachtung zu verschaffen, das doch weiterhin Tag für Tag mit Füßen getreten wird? Zumindest schafft sie einen Rahmen für konkreten Austausch. Es sind bereits anregende und zum Teil auch praxisfähige Berichte aus militärischen und humanitären Workshops entstanden. Beim ersten Treffen der Unterzeichnerstaaten in Oslo im April 2024 wurden einige Vorhaben zur Förderung der zivilen Sicherheit bei militärischen Operationen im Rahmen der Implementierung der EWIPA-Erklärung präsentiert. Schauen wir jedoch auf Initiativen der USA, müssen wir feststellen, dass bereits in den ersten Tagen der Trump-Administration die Beendigung solcher Projekte angekündigt wurde. Es bleibt genau zu beobachten, welche Auswirkungen eine veränderte US-Politik auch auf die anderen Unterzeichnerstaaten der Erklärung haben werden.
Angesichts der weit verbreiteten aktuellen Skepsis über die globale Einhaltung des humanitären Völkerrechts (IHL) und des immer kleiner werdenden zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraums macht es dennoch ein wenig Hoffnung, dass dieser Implementierungsprozess bisher weitgehend inklusiv gestaltet wurde. Er bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Stimmen der von Explosivwaffen Betroffenen in den internationalen Austausch zu EWIPA einzubinden. Das kann dazu beitragen, den Dialog zwischen denjenigen, die von der Einhaltung – oder Nichteinhaltung – des humanitären Völkerrechts betroffen sind, und denjenigen, die für dessen Umsetzung verantwortlich sind, zu fördern. Nicht zuletzt ist es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie echter Austausch entsteht und z.B. Offiziere oder Diplomat*innen mit ernsthaftem Interesse Nujeen, Marwa oder Olha zuhören und sich in ihren Statements auf sie berufen.
Deshalb engagieren wir uns weiter für die Umsetzung der Erklärung – mit einer gewissen Hoffnung, die Nujeen bei der Unterzeichnung in Dublin ausgedrückt hat: „Ich hoffe, dass die Unterzeichnung der Erklärung nicht nur ein Stück Papier, sondern der Beginn einer wirklichen Veränderung sein wird! Die Menschen, die auf der ganzen Welt unter Kriegen leiden, haben das verdient!“
Dr. Eva Maria Fischer leitet die politische Arbeit von Handicap International Deutschland. Seit über 20 Jahren arbeitet sie im Kontext internationaler Abrüstungskampagnen, die von HI mitgetragen werden.